Kant zitieren
Ich brauche Hilfe. Ich muss für meine Hausarbeit Kant zitieren. Ich zitiere durchgehend im Harvard Style, das finde ich am entspanntesten. 1. Wie zitiere ich im Text? Es ist ja irgendwie sinnlos die Jahreszahl anzugeben, da diese ja in dem jeweiligen Buchstaben enthalten ist A für 1781 und B für 1787. Schreibe ich dann einfach so etwas wie (Kant A34/B56). Ich habe nämlich auch einigele gesehen, dass er im Text so zitiert wird (Kant, KrV A34/B56) aber für den Harvardstyle wäre es doch sehr merkwürdig den Titel des betreffenden Buches mit anzugeben.
- Wie zitiere ich im Literatur Verzeichnis? Hier habe ich schlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe die Ausgabe von Felix Meiner aus der Philosophischen Bibliothek (1998). In die Angabe muss also irgendwie rein, dass es die ausgaben von 1781,1787 und 1998 sind. Ich bin verwirrt!
Vielen Dank für die Hilfe!!!
3 Antworten

Wörtliche Zitate sind als solche zu kennzeichnen (üblich ist eine Verwendung von Anführungszeichen).
Auch ohne wörtliches Zitieren kann bei einem Bezug auf den Text zum Nachweis/als Beleg eine Stellenangabe erforderlich sein. Immanuel Kant wird wissenschaftlich nach der Zählung der Akademieausgabe (abgekürzt: AA) zitiert, mit der Bandnummer in römischen Ziffern, der Seitenzahl und gegebenenfalls der Zeilenzahl (durch Komma abgetrennt) in arabischen Ziffern, z. B. AA III 65, 10. Die Kritik der reinen Vernunft kann auch nach der Zählung der Originalausgaben zitiert werden (mit Titel des Werkes, wobei die Abkürzung KrV möglich ist).
Wegen des besonderen Umstandes des Bezugs auf den Text eines älteren Autors mit einer gängigen Standardzählung, die in allen wissenschaftlich brauchbaren Textausgaben angeben wird, kann beim Harvard-System nicht gut unbegrenzt nach dem Schema des Kurzbelegs mit Nachname des Autors, Erscheinungsjahr und Seitenzahl verfahren werden.
Die Standardzählung sollte nicht durch einen Hinweis auf eine Seitenzahl einer modernen Textausgabe ersetzt werden. Mit der Standardzählung kann eine Textstelle in jeder wissenschaftlich brauchbaren Textausgabe eindeutig und ziemlich schnell gefunden werden. Die Seitenzahlen in den modernen Textausgaben, an denen die betreffenden Textstellen stehen, weichen dagegen voneinander ab. Wer nicht die verwendete Textausgabe hat, bekommt Schwierigkeiten.
Ein Erscheinungsjahr einer verwendeten Textausgabe im Kurzbeleg ist seltsam. Denn dies wirkt, als ob Immanuel Kant das Werk erst in diesem Jahr veröffentlicht hätte.
Im Kurzbeleg hinter „Kant“ die Jahreszahl (also „1781“, „1787“ oder „1781/1787“) zu setzen entspricht zwar dem Schema des Harvard-Systems, weicht aber davon ab, wie Kant wissenschaftlich zitiert wird, und ist eine überflüssige Information, weil aus dem Hinweis auf die Akademieausgabe oder auf die Originalausgaben dies schon hervorgeht.
„Kant, KrV A 34/B 56“ ist als Kurzbeleg in Ordnung. „KrV“ ist eine Sigle (Abkürzung des Werktitels durch Buchstaben). Eine Alternative ist eine auf die Akademieausgabe bezogene stellenangäbe.
Im Literaturverzeichnis/der Bibliographie wird nicht zitiert, sondern es werden die genauen bibliographischen Abgaben der für die Hausarbeit verwendeten Literatur (einschließlich von Textausgaben, Übersetzungen und Kommentaren) hineingeschrieben. Im Literaturverzeichnis/der Bibliographie können die Kurzbelege aufgelöst werden (z. B.: Kant, KrV = …).
Es wird angegeben, nach welcher Textausgabe zitiert wird.
Die Jahre ergeben sich dabei (1781 und 1787 sind weitgehend schon durch den Werktitel).
die verwendete Ausgabe ist in diesem Fall offensichtlich:
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Nach der 1. und 2. Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann. Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme. Hamburg : Meiner, 1998 (Philosophische Bibliothek ; Band 505). ISBN 3-7873-1319-2
Einige formale Einzelheiten (ob z. B. ein Muster Vorname, Nachname, oder ein Muster Nachname, Vorname verwendet wird, ob danach ein Komma oder ein Doppelpunkt gesetzt wird, inwieweit lieber abgekürzt wird [etwa „hrsg.“ für „herausgegeben“]; ISBN wird meistens nicht genannt, oft auch nicht der Verlag) hängen von den Vorgaben der Hochschule ab. In dieser Hinsicht ist es nötig, sich über die betreffende Vorgabe zu erkundigen und zu informieren. Auf jeden Fall sollte die Handhabung in der ganzen Hausarbeit einheitlich sein.
Die Betreungsperson bei der Hausarbeit ist ein Ansprechpartner für Probleme.
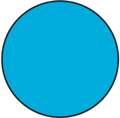
Solche Fragen beantwortet man mit dem ebenfalls entspannten google style:
Für dich interessant ist Seite 24:
9.2.7 Dokumente eines Autors: dasselbe Jahr
Wie es im Litertaurverzeichnis auszusehen hat, ist auch sehr schnell gefunden.

Nun das hilft mir nicht. Die beiden Kritiken sind ja in unterschiedlichen Jahren herausgekommen, werden aber als EIN Werk zitiert. Niemand listet die KrV im Literaturverzeichnis als zwei Werke auf.