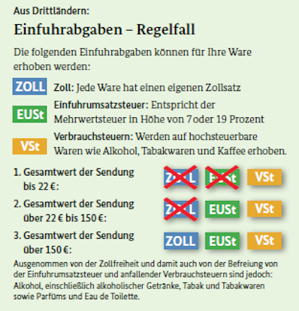Hallo siotaa!
Vielen Dank für die Frage. Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach, deshalb möchten wir uns hier auf das von Dir genannte Beispiel Griechenland konzentrieren. Denn die Situation in jedem Land ist anders, Portugal und Irland zum Beispiel haben die Stabilitätsprogramme sehr erfolgreich abgeschlossen und erholen sich heute viel schneller als erwartet.
Aber keine Frage: Europa muss aus der Griechenland-Krise wichtige Lehren ziehen. Die Griechenland-Krise hat vieles hervorgebracht, darunter europäische Solidarität, aber auch einschneidende Sparmaßnahmen und nationale Egoismen.
Viele sind der Auffassung, dass die Europäer zu großzügig gegenüber einem Land waren, das allein dafür verantwortlich gewesen sei, dass es fast zum Bankrott kam. Andere betrachten die aufeinanderfolgenden Finanzhilfeprogramme als brutale Sparmaßnahmen. Wieder andere sind der Ansicht, dass diese Krise auf existenzielle und heilsame Weise ins Bewusstsein gerufen hat, wie anfällig das Euro-Währungsgebiet ist.
Seit das letzte Finanzhilfeprogramm im Sommer 2018 ausgelaufen ist, steht Griechenland wieder auf eigenen Beinen.
Aus unserer Sicht ist zunächst festzuhalten, dass es richtig war, Griechenland zu retten. Die 288 Mrd. Euro, die die europäischen Staaten und der Internationale Währungsfonds in acht Jahren aufgebracht haben, waren notwendig, um ein politisches und wirtschaftliches Chaos zu vermeiden. Ohne europäische Hilfe wäre Griechenland zusammengebrochen und in ein tiefes politisches und wirtschaftliches Chaos geraten, vielleicht für Jahrzehnte.
Ein Zusammenbruch Griechenlands hätte verheerende Folgen für die Menschen in Griechenland, für die gesamte Region Südosteuropa und auch verheerende Folgen für einige unserer Volkswirtschaften gehabt. Sie wären mit in den griechischen Abgrund gerutscht. Das in den letzten Jahren starke Wachstum in Europa (auch in Griechenland!) hätte es nicht gegeben. Somit war es richtig, Griechenland zu retten. Zum Schutz unserer Volkswirtschaften, des Euro und Europas. Als Kollektiv hat uns das Ganze stärker gemacht.
Der Ausstieg Griechenlands aus dem Finanzhilfeprogramm 2018 war eine gute Nachricht sowohl für Griechenland als auch für das Euro-Währungsgebiet. Er markiert das Ende von acht Krisenjahren, die für das griechische Volk schmerzhaft und für das Euro-Währungsgebiet destabilisierend waren.
Trotz aller Sparmaßnahmen und Reformen ist die Situation vor Ort nach wie vor schwierig. Wir können nachvollziehen, wenn viele Griechen meinen, die Krise sei noch nicht überstanden: Ein großer Teil der Bevölkerung lebt noch unterhalb der Armutsgrenze, die Arbeitslosenquote liegt bei über 20 Prozent. Der gesamtstaatliche Schuldenstand ist mit 180 Prozent des BIP nach wie vor einer der höchsten in Europa.
Aber: Das Schlimmste haben wir hinter uns. Wir haben das Katastrophenszenario eines Grexit verhindert und den Euro gerettet. Griechenland ist wieder auf Wachstumskurs, das abgrundtiefe Staatsdefizit hat sich in einen soliden Haushaltsüberschuss umgekehrt, die Arbeitslosigkeit sinkt allmählich, und junge Menschen, die während der Krise ausgewandert waren, kehren in ihr Land zurück. Damit ist die krisenbedingte Dringlichkeit der Sparmaßnahmen nicht mehr gegeben.
Das Ende des Programms bedeutet jedoch nicht das Ende des Weges. Es gibt noch viel zu tun, damit Griechenland dauerhaft erfolgreich bleibt.
In der Rückschau müssen wir einräumen, dass sowohl in Athen als auch in Brüssel, Berlin und Washington Fehler begangen wurden, welche die Krise unnötig verlängert haben.
Wir hatten weder die Analysefähigkeiten noch die Instrumente, geschweige denn die politische Kultur, um große Krisen mit der Geschwindigkeit der Märkte zu bewältigen. Wir haben diese Krise nicht kommen sehen und waren unvorbereitet. Wir haben die Lage in Griechenland unterschätzt. Die vermeintliche Haushaltskrise war in Wirklichkeit eine tiefgreifende Krise des griechischen Staates und der griechischen Wirtschaft. Um ihr wahres Ausmaß zu erkennen, haben wir Jahre gebraucht.
Das erste Programm (2010-2012) war zu kurzfristig angelegt und zu stark auf die öffentlichen Finanzen ausgerichtet. Es ermöglichte daher kein Einwirken auf die strukturellen Probleme des Landes. Das zweite Programm (2012-2015) bot zwar mehr inhaltliche Antworten, war aber ebenfalls zeitlich zu begrenzt. Erst das dritte Programm (2015-2018) ermöglichte es, die erforderlichen Strukturreformen festzulegen und konkret umzusetzen.
Auch die griechische Politik trägt einen großen Anteil an der Krise. Defizitzahlen wurden geschönt. Die von Demagogie geprägten Wahlkämpfe, die abrupte Umkehr politischer Positionen nach einer Regierungsübernahme und der fehlende nationale Konsens haben den Aufschwung des Landes nachhaltig gebremst.
Das zweite Hilfsprogramm hätte im Dezember 2014 erfolgreich abgeschlossen werden können, wenn die Koalition aus Nea Dimokratia und PASOK die Rentenreform und die Mehrwertsteuererhöhung auf den griechischen Inseln politisch in Angriff genommen hätte. Stattdessen wurden Neuwahlen angesetzt. Dabei wählten die Griechen die Koalition der radikalen Linken (Syriza) auf der Basis eines diametral entgegengesetzten Wahlprogramms in die Regierung, was zu sechsmonatigen Spannungen mit der EU und auf den Märkten führte.
Auch europäische Politiker haben Anteil an der Krise. Aus Angst vor einer Implosion des Euro handelten sie zögerlich und versteckten sich zu lange hinter dem griechischen Zaudern. Vieles war stark von politischen Hintergedanken geprägt. Aufseiten der europäischen Rechten wünschten sich manche ein Scheitern der Syriza-Regierung unter Alexis Tsipras, dem Bezwinger der Nea Dimokratia. Und nicht selten überlagerten Emotionen die politische Rationalität.
Der EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen Pierre Moscovici musste erleben, wie der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble seinem griechischen Amtskollegen unverblümt mitteilte, dass er ihm nicht mehr vertraue. Und einmal musste Moscovici den niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem und den griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis voneinander trennen, bevor es womöglich zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre. Es hat viel Geduld erfordert, bis im Sommer 2015 der Dialog wieder aufgenommen und mithilfe des dritten Finanzhilfeprogramms, das ohne diese politischen Querelen gar nicht notwendig gewesen wäre, ein Weg aus der Sackgasse gefunden werden konnte.
Nicht zuletzt muss die Rolle der zuständigen Institutionen bei der Durchführung der Programme angesprochen werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und dem in der Folge als Teil des „Euro-Rettungsschirms“ eingerichteten Europäischen Stabilitätsmechanismus war nicht immer einfach. Zwar hat uns die Finanzexpertise des IWF geholfen, doch einige zu extreme und zu persönliche Standpunkte von IWF-Mitarbeitern haben unseren Beziehungen zu den Griechen geschadet und sogar dazu geführt, dass die Euro-Gruppe unseres Erachtens zu harte Reformen beschlossen hat, insbesondere die Rentenreform für 2019.
Für die acht lange Jahre andauernde Krise war zum Teil auch die politische Führung verantwortlich. Wir selbst möchten uns als Europäische Kommission hiervon nicht ausnehmen. Viele von uns haben ihr Bestes gegeben, um die Menschen zu entlasten. Auch haben wir uns stets dafür eingesetzt, soziale Härten abzufedern, wobei Pierre Moscovici und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dieser Position in der Euro-Gruppe bisweilen allein waren. Aber auf dieses Festhalten sind wir stolz.
Die Rolle der sogenannten Troika und ihrer „Herren in Schwarz“, also der Experten von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, muss hier genauer erörtert werden. Es hieß, der Wille des Volkes sei nicht respektiert worden, ein Bündnis aus Märkten und nicht gewählten Technokraten hätte dem griechischen Parlament seine Maßnahmen aufgezwungen. Die häufig kritisierten Technokraten waren zugegebenermaßen oft eindringlich. Wir brauchten aber Fachleute, um die Lage in Griechenland richtig einschätzen und das Land besser unterstützen zu können.
Die griechische Demokratie wurde in all ihren Grundsätzen stets in vollem Umfang geachtet. Das griechische Volk hat sich dafür entschieden, im Euro-Währungsgebiet zu verbleiben, und wir haben diese souveräne Entscheidung respektiert. Es stimmt, dass konkrete Maßnahmen von den Institutionen vorbereitet wurden. Das Mandat hierzu hatten sie von europäischen Ministern, die wiederum ihren jeweiligen Parlamenten gegenüber rechenschaftspflichtig waren. Jede große Reform ist letztlich durch das griechische Parlament legitimiert worden.
Die Entscheidungen in der Euro-Gruppe jedoch wurden ohne ausreichende demokratische Kontrolle gefällt. Auch dem EU-Kommissar Moscovici war nicht wohl dabei, wenn in der Euro-Gruppe hinter verschlossenen Türen über das Schicksal von Millionen Griechen entschieden wurde. Aus demokratischer Sicht war das deshalb skandalös, weil nur wenige Minister hinreichend informiert waren und über ein präzises Mandat verfügten.
Wir ziehen daraus die eindeutige Lehre, dass die Euro-Gruppe demokratischer, transparenter und auf europäischer Ebene stärker parlamentarisch kontrolliert werden muss.
Griechenland ist dabei, wieder seinen rechtmäßigen Platz im Euro-Währungsgebiet einzunehmen und wieder größere Autonomie in seiner Wirtschaftspolitik zu erlangen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Europäische Union Griechenland nun seinem Schicksal überlässt. Es gibt noch viel zu tun.
Für die griechische Regierung muss es weiter oberste Priorität haben, den gesamtstaatlichen Schuldenstand abzubauen und die Reformen fortzusetzen.
Die EU-Kommission bleibt an der Seite Griechenlands, muss aber gleichzeitig sicherstellen, dass Griechenland seinen Verpflichtungen nachkommt. Das diesbezügliche Monitoring ist jedoch kein viertes Programm. Es beinhaltet keine neuen Forderungen nach Maßnahmen oder Reformen. Für Griechenland geht es darum, die von seinen Partnern geleistete Unterstützung für die Vollendung wichtiger Reformen zu nutzen, und seine europäischen Partner erwarten, dass Griechenland seinen eingegangenen Verpflichtungen nachkommt - nicht mehr und nicht weniger!
Das Euro-Währungsgebiet hingegen muss seine Integrationsarbeit fortsetzen und sich Gedanken über die nächsten Krisen machen, die zwangsläufig auf uns zukommen werden. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Entsprechende Vorschläge haben wir bereits unterbreitet. Wir hoffen, dass die Staaten so weise sein werden, die Wirtschafts- und Währungsunion mit Zuversicht und Gestaltungswillen zukunftsfest zu machen.
Weitere Infos zum Abschluss des Stabilitätshilfeprogramms für Griechenland: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_de.htm
Viele Grüße vom Presseteam der Europäischen Kommission in Deutschland