Woher hat das Zoo die Tiere?
Im Zoo sieht man ja auch Wildtiere und Tiere die es hier in Europa eigentlich garnicht gibt. Woher hat das Zoo diese Tiere? Werden sie mit gewallt hier her gebracht?
8 Antworten

Einige Tiere werden aus anderen Zoos gekauft, wo diese oft geboren wurden. Das bedeutet, dass die meisten Tiere im Zoo, ihr ganzes Leben in einem Zoo verbracht haben.
Werden Tiere allerdings aus der Wildnis geholt, sind das oft verletzte bzw. gefährdete Tiere bzw. Tierarten, welche von Tierpflegern geheilt wurden und an den Zoo übergeben werden.
Nur ganz selten werden Tiere einfach so aus der Wildbahn geholt und noch seltener durch Gewalt. Vorallem in Ländern wie Deutschland kann man sich dessen relativ sicher sein, da sowas hier streng von Tierschützern überwacht wird.
In ärmeren Ländern wo diese nicht so viel Einfluss haben, kann man sich nicht ganz sicher sein, ob keine Gewalt zum Einsatz kam.

kein Tier geht freiwillig mit (oder höchstens weniger als 1%) ... in der regel kriegen die nen betäubungspfeil reingeschossen oder man lockt sie in wägen macht die tür zu und abtransportiert, was sie auch nicht wollen, die Tiere und total ängstlich sind ... und das ist keine Gewalt ?
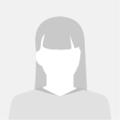
Urspünglich aus Wildfängen, mittlerweile aus weltweiten Nachzuchten.

Ja irgendwann wurden Löwen/Bären/Giraffen importiert. Die Tiere die du jetzt siehst sind aber meist Züchtungen die hier entstanden sind.
Wenn ein Zoo z.B. Löwennachwuchs hat kann der nicht komplett in dem Zoo bleiben. Die männlichen Babys bekämen Probleme mit dem Rudelführer und der Platz würde nicht reichen. Also werden die irgendwann verkauft, an andere Zoos

Ich meine eher, dass der rudelführer auch seine eigenen Söhne sobald sie größer werden nicht mehr toleriert, schließlich könnten die versuchen ihn zu stürzen und sein Rudel zu übernehmen. In der Wildnis werden die jungen Löwen fortgejagt und gehen alleine auf Wandertour bis sie ein Rudel gründen oder ein fremdes übernehmen. Im Zoo können die Löwen nirgends hin, holt man den männlichen Nachwuchs nicht rechtzeitig raus würde der Anführer seine Söhne töten so lange er sicher sein kann, das er stärker ist

Heutzutage sind die meisten Zootiere Nachzuchten die in einem Zoo geboren wurden. Bei vielen Arten ist es auch garnicht erlaubt sie irgendwo einfach einzufangen weil sie besonders geschützt sind.

Früher und ursprünglich stammten viele Zootiere aus der Wildnis. Von professionellen Tierfängern wurden sie extra für Zoos gefangen. Das war noch bis in die 1960er/1970er Jahre hinein eine gängige Praxis. Als 1962 der Film Hatari! mit John Wayne, Elsa Martinelli und Hardy Krüger gedreht wurde, waren die Tierfangszenen echt und die gefangenen Tiere wurden nach den Dreharbeiten wirklich an Zoos verkauft, eine Gepardin ging z. B. an den Zoo in Los Angeles.
Und Dian Fossey berichtet in ihrem Buch Gorillas im Nebel ausführlich darüber, wie sie die Pflegschaft für zwei Berggorillaweibchen übernahm, die später als Geschenk der Regierung Ruandas an den Kölner Zoo gingen, wo sie zwischen 1969 und 1978 lebten.
Heute ist das anders. Entnahmen aus der Wildnis sind heute die Ausnahme - auch, weil viele im Zoo gehaltene Tierarten in ihren Beständen bedroht sind und jede Entnahme aus der Natur die Bestände nur unnötig verringern würde.
Zum Glück sind Wildfänge heute bei den meisten Tierarten aber auch unnötig. Bei vielen Tierarten hat man in den letzten Jahrzehnten sehr viel über deren Biologie und Lebensweise herausgefunden und es gelingt immer besser, diese zu züchten. Viele Tierarten, darunter z. B. so beliebte Tiere wie die Großkatzen, Giraffen oder Zebras, lassen sich sehr einfach vermehren und sind nun schon in mehrfacher Generation in Zoos geboren worden. Wildfänge gelangen heute nur noch zur "Blutauffrischung" in die Zoos oder wenn ein Tier illegal gefangen und anschließend vom Zoll beschlagnahmt wurde.
Die Bemühungen der Zoos setzen ein ausgeklügeltes Zuchtmanagement voraus. Weltweit beteiligen sich Zoos an Nachzuchtprogrammen insbesondere für bedrohte Tierarten. Die Zeiten des Tierhandels sind dabei längst vorbei und die Zoos tauschen untereinander ihre Tiere aus, dort wo sie sozusagen gebraucht werden. Dieser Tiertausch kostet in der Regel nichts, es hat sich aber eingebürgert, dass derjenige Zoo, der das Tier erhält, für die Transportkosten von Zoo A in Zoo B aufkommt.
Management, das bedeutet aber nicht nur, dass Tiere zwischen den Zoos getauscht werden. Es bedeutet auch, dass dabei geplant gezüchtet werden muss. Ein Zoo darf nicht nach Belieben mit seinen Tieren züchten. Auch wenn Tierbabies süß und niedlich sind und als Besuchermagnet für einen finanziellen Zuwachs sorgen, werden die Tierkinder irgendwann einmal groß und da ein Zoo nur begrenzten Platz hat, müssen sie daher an einen anderen Zoo oder Tierpark vermittelt werden können. Das heißt also, dass man auch nur dann züchten kann, wenn man später für die Nachzuchttiere einen Abnehmer hat.
Schwierig ist es außerdem, dabei die genetische Variabilität, aber auch die Eigenständigkeit von Populationen in der Natur zu erhalten. Vor allem in den Anfangsjahren hat man gerne Tiere aus unterschiedlichsten Herkunftsgebieten miteinander verpaart, die verschiedenen Unterarten angehörten. Das Ziel war damals, möglichst spektakuläre Tiere zu präsentieren. So hat man z. B. früher sehr häufig Amurtiger (die größte Unterart des Tigers) mit Sumatratigern (diese haben einen besonders imposanten "Backenbart") gekreuzt. Heute ist es das Ziel, wo immer dies möglich ist die Tiere als eigenständige Populationen zu erhalten, also nur Tiere der gleichen Unterart miteinander zu verpaaren. Gleichzeitig soll aber die genetische Vielfalt im Zoo erhalten bleiben und nicht durch zu viel Inzucht verlorengehen. Das setzt umfangreiche Studien über die Populationsgenetik der Zootiere und natürlich auch im Freiland voraus und eine akribische Dokumentation. Eine Grundlage dafür ist das Erstellen so genannter Zuchtbücher, die es sowohl auf europäischer Ebene (European Studbook, ESB) als auch international (International Studbook, ISB) gibt. Eines der umfangreichsten Zuchtbücher überhaupt ist z. B. das ISB für den Tiger, welches bereits seit den 1970ern im Zoo Leipzig geführt wird, dem weltweit erfolgreichsten Tigerzüchter. Dieses Buch ist die Grundlage für die "Heiratsvermittlung" sämtlicher Tiger, die weltweit in einem Zoo gehalten werden und gibt Auskunft über seine Unterartzugehörigkeit, seine Abstammung, seine Nachkommenschaft und so weiter. Auf dieser Basis können dann Zuchtbuchempfehlungen erstellt werden, also z. B. genetisch sehr wertvolle Paare zusammengestellt werden, deren Gene in der Zoopopulation noch nicht sehr verbreitet sind.
Mitunter müssen beim Management jedoch auch Abstriche gemacht werden, wenn man von einer sowieso nur geringen Ausgangsbasis aus starten muss. Das war z. B. beim Amurleopard der Fall. Als man mit dem Aufbau eines Zuchtbuchs für diese seltenste Unterart des Leoparden begann, war der Amurleopard in der Natur fast ausgerottet, nicht einmal 50 Tiere hatten überlebt und in Zoos wurden weltweit allenfalls genauso viele gehalten. Um diese Unterart zu erhalten, wurde daher in Kauf genommen, dass man einige Leoparden einkreuzen musste, die nicht "unterartenrein" waren, sondern auch einige Ahnen der Unterart des China-Leoparden hatten.
Man darf gespannt sein, wie sich die Zukunft in der Bemühung um die Erhaltung bedrohter Arten entwickeln wird. Einerseits wird weiterhin Wissen gesammelt über solche Arten, die sich heute noch nicht gut vermehren lassen oder noch nie in einem Zoo gezüchtet werden konnten. So lassen sich beispielsweise Flamingos immer noch vergleichsweise schwer züchten. In der Natur leben diese Tiere in riesigen Schwärmen und sind durch ihren eigentümlichen Schwarmbalztanz charakterisiert. Diese Bedingungen im Zoo zu imitieren, ist nicht ganz leicht und bis heute sind noch nicht alle Details geklärt und noch viele Fragen offen, warum die Tiere im Zoo so schlecht brüten. Durch viel Herumprobieren gelingt es heute aber schon immer mehr Zoos, Flamingos zu züchten und die Resultate werden auch immer besser. Zum Einsatz kommen heute z. B. Spiegelfolien, um die Größe eines aus vielen, vielen Tieren bestehenden Schwarms zu imitieren.
Andererseits verspricht auch die Technik der modernen Reproduktionsmedizin enorme Fortschritte für die zukunft. Schon heute gibt es einzelne Tierarten, bei denen man keine Wildtiere mehr fangen muss, um neues Blut in die Zuchtlinien in menschlicher Obhut zu bringen. Stattdessen werden Wildtiere betäubt und anschließend Samen- oder Eizellen entnommen, tiefkühlkonserviert und anschließend für die künstliche Befruchtung eingesetzt. Ein besonders ambitioniertes Projekt, bei dem das Berliner Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) federführend ist, bemüht sich beispielsweise um den Erhalt des Nördlichen Breitmaulnashorns durch den Einsatz künstlicher Befruchtungstechniken.
ja das stimmt : bei Tierarten mit rudelführer kommt es vor, dass der rudelführer keine Tierkinder von anderen Vätern toleriert. er weiss normal welche von anderen Vätern sind und versucht sie zu töten. alle Tierkinder im rudel haben den selben Vater.