Gibt es noch andere Lebewesen im Universum?
7 Antworten

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber wir haben gerade leider keine Glaskugel zum Nachsehen.

Ich habe eine,aber die sagt mir nichts!, ich sehe in ihr nur ein Stern!!

Meine Recherchen dazu haben folgendes für dich herausgefunden :
Die Antwort kann man mit wenigen Worten zusammenfassen: weil das Universum praktisch unendlich groß ist. Nach derzeitigen Schätzungen enthält es rund zwei Billionen Galaxien, die wiederum aus vielen, vielen Sternen bestehen. Wie viele es im Schnitt sind, da gehen die Schätzungen auseinander. Manche gehen davon aus, dass es ganz grob insgesamt etwa 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Sterne gibt und wir sprechen hier nur vom beobachtbaren Universum. Also dem Teil des Universums, aus dem bisher das Licht der Sterne bis zu uns gelangt ist. Wie groß das Universum darüber hinaus ist, wissen wir nicht. Da Sterne oft von mehreren Planeten umkreist werden, sollte es also im Universum noch mehr Planeten als Sterne geben und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass darunter auch welche sind, die unserer Erde ähneln: Nicht zu nah am Zentralstern, damit es nicht zu heiß ist, und nicht zu weit weg, damit nicht alles Leben erfrieren würde.
Darüber hinaus müssten nach unserem heutigen Wissen noch ein paar weitere Bedingungen erfüllt sein, damit die Entstehung von Leben, so wie wir es kennen, möglich wäre. Der Planet sollte zum Beispiel flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche haben und ein ausreichend starkes Magnetfeld besitzen, um ihn vor gefährlicher kosmischer Strahlung zu schützen.
Forschende schätzen, dass es in der Milchstraße hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden bewohnbare Planeten geben könnte. Im ganzen beobachtbaren Universum sollen es nach derzeitigem Wissensstand um die fünf Billionen sein.
Der US-amerikanische Astronom Frank Drake hat in den 1960er-Jahren eine Formel aufgestellt, mit der man berechnen könnte, wie viele technisch fortgeschrittene Zivilisationen es alleine in unserer Milchstraße geben müsste. Die nach ihm benannte Drake-Formel hat aber einen großen Haken: Die meisten Wahrscheinlichkeiten, die in diese Formel einfließen, sind unbekannt oder nur sehr grobe Schätzungen. Einer der Werte ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem erdähnlichen Planeten intelligentes Leben entsteht. Wir verstehen aber bisher nicht, wie intelligentes Leben auf der Erde entstehen konnte und wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist!
Gedankenexperiment Drake-FormelDeshalb kann man mit der Drake-Formel nicht ernsthaft eine genaue Wahrscheinlichkeit für intelligentes Leben in unserer Milchstraße oder im All ausrechnen. Sie ist eher als Gedankenexperiment zu betrachten. Die Formel macht klar: Selbst eine nur winzige Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von intelligentem Leben auf einem bestimmten Planeten ist kein Hindernis für intelligentes Leben im All.
Denn diese geringe Wahrscheinlichkeit wird dadurch wettgemacht, dass es so unzählig viele erdähnliche Planeten gibt. Dadurch steigt die Gesamtwahrscheinlichkeit wieder so weit, dass die Existenz von außerirdischem intelligentem Leben plausibel erscheint.
Wenn man es für möglich hält, dass es andere technisch hochentwickelte Zivilisationen im All gibt, wie können wir das herausfinden? Um die Frage zu klären, versuchen Forschende seit den 1960er-Jahren mit sogenannten SETI-Projekten systematisch, außerirdische Lebenszeichen zu empfangen. SETI ist die Abkürzung für "Search for Extra-Terrestrial Intelligence“, was man umgangssprachlich mit "Alien-Fahndung“ übersetzen könnte.
SETI als "Alien-Fahndung"
Die Forschende nutzen dafür Radioteleskope, von denen manche mehrere Hundert Meter große Empfangsschüsseln haben. Sie sind damit so empfindlich, dass sie auch extrem schwache Funksignale auffangen könnten. Mittlerweile ist in die Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen auch der russischstämmige Silicon-Valley Milliardär Yuri Milner eingestiegen. Er finanziert mit seinem "Breakthrough Listen“-Projekt Wissenschaftler:innen, die neben Radiosignalen zusätzlich nach Lasersignalen fahnden.
Denn auch damit könnten technisch hochentwickelte Zivilisationen über weite Distanzen im All kommunizieren. Trotz aller Anstrengungen wurde bisher aber noch keine außerirdische Botschaft aufgefangen - bis auf eine potenzielle Ausnahme.
Das "Wow!"-Signal
Am 15. August 1977 wertet der Astronom Jerry Ehman die Empfangsdaten des Radioteleskops der Ohio State University aus und traut seinen Augen kaum: In den Ausdrucken sticht ein Signal aus dem üblichen Rauschen heraus: Es ist außergewöhnlich stark und deckt nur einen schmalen Frequenzbereich ab, so wie ein Rundfunksender auch nur auf einer bestimmten Frequenz sendet. Jerry Ehman ist so erstaunt, dass er auf dem Ausdruck neben das Signal "Wow!" schreibt, daher der Name.
Kam es jetzt von Außerirdischen? Das könnte theoretisch schon sein, aber leider war die damalige Technik nicht empfindlich genug. Das Signal war deshalb zu verrauscht, um das entscheiden zu können. Es könnte auch von einem bisher unbekannten astronomischen Ereignis oder von der Erde stammen. Aber auch diese alternativen Erklärungsmöglichkeiten überzeugen nicht restlos. Bisher wurde kein weiteres Signal dieser Art empfangen.
Der große Filter
Ende des letzten Jahrhunderts kam die Idee des "Großen Filters" auf. Sie besagt, dass jede Menge Schritte überwunden werden müssen, damit eine Zivilisation entsteht und dann auch lange genug lebt, um sich im Weltall bemerkbar zu machen: Erst einmal muss es einen geeigneten Planeten geben, dann muss auf ihm primitives Leben entstehen, das sich dann aus dem Einzeller-Stadium zu Mehrzellern weiterentwickelt.
Aus diesen müssten dann tierähnliche Wesen entstehen, die lernen, Werkzeuge zu benutzen und die ihre Technikbeherrschung so weiterentwickeln, dass sie eine hochentwickelte Zivilisation schaffen. Diese müsste lange genug bestehen, damit sie die Technik erfindet, die sie über ihren Planeten hinaus kommunizieren lässt. Schließlich könnte diese Zivilisation ihren Heimatplaneten vielleicht sogar verlassen, um sich im Weltraum auszubreiten.
Was davon ist unwahrscheinlich?
Jeder dieser Schritte könnte der "Große Filter" sein, also eine Art Barriere, die das Entstehen Galaxien besiedelnder Zivilisationen verhindert. Denn wenn nur einer dieser Schritte extrem unwahrscheinlich ist, könnte das erklären, warum wir noch nicht auf außerirdisches Leben gestoßen sind.
Vielleicht ist schon die Entstehung von primitiven Lebensformen extrem unwahrscheinlich oder das Aufkommen von Werkzeuggebrauch oder ein anderer Schritt zu einer das Weltall besiedelnden Zivilisation. Der letzte mögliche "Filter" wäre, dass technisch hochentwickelte Zivilisationen nur eine begrenzte Lebensdauer haben, weil irgendetwas dazu führt, dass sie sich nach relativ kurzer Zeit unweigerlich selbst zerstören.
Zerstören wir uns vielleicht selbst?
In unserem Fall ist nicht klar, ob wir es mit der Entstehung von intelligentem Leben schon geschafft haben und durch den "Großen Filter" gekommen sind oder ob die große Hürde noch vor uns liegt. Dann liegt unsere große Herausforderung darin, unsere Lebensgrundlage nicht selbst zu zerstören, wenn wir nicht bald wieder zugrunde gehen wollen.
Die kommende Generation von Weltraumteleskopen könnte eine Antwort darauf liefern, ob der "Große Filter" schon hinter uns oder noch vor uns liegt. Denn wenn wir mit ihnen viele Zeichen von anderen technisch hochentwickelten Zivilisationen auffangen, wäre das ein positives Zeichen. Das würde heißen, dass wir den härtesten Schritt mit der Entstehung von intelligentem Leben bereits überwunden haben. Somit hätten wir das Potenzial, noch sehr lange weiterzubestehen.
Finden wir aber primitives Leben auf anderen Planeten, ohne gleichzeitig auch auf technisch entwickelte Zivilisationen zu stoßen, wäre die Schlussfolgerung deprimierend. Das hieße nämlich, dass die Entstehung von Leben im All relativ häufig ist, aber dass sich daraus entwickelnde Zivilisationen rasch wieder selbst zerstören. Denn sonst müsste man viele von ihnen finden.
Wie könnte außerirdisches Leben aussehen?
Schon auf der Erde ist es schwer, zu definieren, was "Leben" genau sein soll. Die Kriterien, die lebende Organismen erfüllen, sind unter anderem Wachstum, Vermehrung, Stoffwechsel und Energieaufnahme aus der Umwelt. Und Lebewesen haben eine Grenze zur Außenwelt, wie etwa eine Zellmembran. Aus mineralischen Salzlösungen wachsende Kristalle erfüllen schon einige dieser Kriterien wie Wachstum und eine klare Abgrenzung zur Außenwelt, aber es fehlt ihnen noch die Fortpflanzung.
Diese beherrschen aber zum Beispiel Viren, brauchen dafür aber zwingend Wirtszellen, in denen sie sich vermehren. Sind Viren deshalb kein Leben? Bei ihnen ist die Abgrenzung zwischen belebt und unbelebt schon unklarer. Das Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, Leben wirklich genau zu definieren.
"Lebenschemie" könnte auf anderen Planten anders sein
Auf anderen Planeten wäre es zum Beispiel denkbar, dass "Leben" mit ganz anderen chemischen Prozessen abläuft als auf der Erde. Eine "Lebenschemie" könnte man sich statt mit Kohlenstoff prinzipiell auch mit Silizium als einem der zentralen Elemente vorstellen. Da wir solche biochemisch grundsätzlich anderen Lebensformen aber noch nie nachgewiesen haben, bleiben sie bis auf Weiteres Spekulation.
Die Forschenden konzentrieren sich bei der Suche nach Leben im All deshalb auf "Biosignaturen" wie die, die wir von irdischem Leben kennen. Biosignatur ist dabei nur der wissenschaftlichere Begriff für "Lebensspur". Das können einfache Moleküle sein, wie Methan, das oft von Bakterien produziert wird, oder kompliziertere organische Moleküle, wie die, aus denen unsere Erbsubstanz besteht. Es können aber auch Spuren von versteinerten Bakterien oder höheren Organismen sein, wie sie auf der Erde in sehr vielen Gesteinsschichten enthalten sind.
Gibt es Leben in unserem Sonnensystem?
Wenn wir nach Leben außerhalb der Erde suchen, fahnden wir erst mal nach einer der wichtigsten Grundlage von Leben so wie wir es kennen: Wasser. Der Merkur scheidet deshalb schon mal aus: Er ist zu klein und hat deshalb zu wenig Schwerkraft. Alles Wasser, das es auf ihm vielleicht einmal gab, ist deshalb ins Weltall verdampft.
Etwas weiter weg von der Sonne kreist die Venus. Sie ist größer als der Merkur und deshalb gibt es auf ihr zwar etwas Wasser, aber leider in der Form von Schwefelsäure-Wolken. Noch dazu ist es auf der Venusoberfläche um die 450 Grad heiß und der Atmosphärendruck ist fast 100-mal höher als auf der Erde. Insgesamt also sehr extreme Bedingungen, die Leben sehr unwahrscheinlich machen.
Ganz nahe bei uns liegt der Mond. Aber auf seiner Oberfläche würde jeder Wassertropfen sofort verdampfen. Er ist deshalb staubtrocken und Wasser könnte es dort - wenn überhaupt - nur als Eis in schattigen Kratern oder unter der Oberfläche geben.
Immer noch kein Leben auf dem Mars entdeckt
Ein Planet, der schon lange die Fantasie der Astrobiolog:innen anregt, ist unser Nachbarplanet, der Mars. Astrobiolog:innen sind die Forschende, die nach Leben im All suchen. Noch vor etwas über 100 Jahren glaubte man sogar, dass eine vermutete Marszivilisation ein riesiges Bewässerungssystem angelegt hatte. Das sind die berühmten Marskanäle, die sich aber schließlich als optische Täuschungen herausstellten. Die ersten Marssonden fanden nur einen staubtrockenen Wüstenplaneten vor.
Mittlerweile wissen wir aber, dass sich an den Marspolen dicke Wassereisschichten ansammeln, und es wird weiteres Eis und vielleicht auch flüssiges Wasser im Boden vermutet. Vor über 3,5 Milliarden Jahren könnten auf dem Mars sogar große Flüsse geflossen sein, das zeigen beeindruckende Täler und Canyons auf dem Mars. Er könnte von den Umweltbedingungen her der frühen Erde geähnelt haben und die vielleicht damals entstandenen Lebensformen könnten heute eventuell noch im Boden schlummern. Bisher hat aber noch keine Marssonde einen klaren Beweis für Leben auf dem Mars gefunden - egal ob vergangenes oder noch heute existierendes.
Methan auf dem Mars
Aber eine mögliche Biosignatur des Mars hat für viel Aufregung gesorgt: Der Mars-Rover Curiosity wies 2004 Spuren von Methan in der Mars-Atmosphäre nach. Es könnte durch geologische Prozesse wie vulkanische Aktivität freigesetzt worden sein, es könnte aber auch die lang ersehnte heiße Spur zu Leben auf dem Mars sein. Denn Methan wird auf der Erde in großen Mengen von Bakterien freigesetzt. Leider konnten die Methan-Messungen bisher nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Der europäische Trace Gas Orbiter, der mit seinen extrem empfindlichen Methan-Messgeräten seit 2017 um den Mars kreist, konnte keinerlei Methanspuren in der Atmosphäre nachweisen.
Zurzeit werden deshalb zwei mögliche Erklärungen für die Methanmessungen des Mars-Rovers diskutiert: Methan könnte auf dem Mars in Bodennähe entstehen, aber sehr schnell wieder abgebaut werden, bevor es in höhere Atmosphärenschichten gelangen kann. Denn nur dort kann es der Trace Gas Orbiter nachweisen. Oder es handelt sich um einen Messfehler … Kommende Marsmissionen werden unter anderem versuchen, das Mars-"Methanrätsel" aufzuklären.
Weitere Kandidaten für Leben in unserem Sonnensystem
Jenseits des Mars wird es eng für Leben in unserem Sonnensystem: Auf den großen, aus Gas bestehenden Planeten Jupiter und Saturn ist es nicht vorstellbar. Und auf Uranus und Neptun ist es extrem kalt: Die Temperaturen in der Atmosphäre sinken unter minus 200 Grad Celsius. Auf Neptun ist der Druck in der Atmosphäre noch dazu so hoch, dass sich dort Diamanten aus kohlenstoffhaltigen Anteilen der Atmosphärengase bilden könnten, ähnlich wie bei uns Schneeflocken aus Wasserdampf entstehen.
Wir sprechen hier also von wirklich extremen Bedingungen, die Leben unmöglich erscheinen lassen. Hoffnungen setzen die Astrobiolog:innen derzeit aber auf diverse Monde in unserem Sonnensystem: Richtig viel Wasser scheint es zum Beispiel auf dem Saturn-Mond Enceladus und dem Jupiter-Mond Europa zu geben: Beide sind von einer Eisschicht bedeckt, aber darunter haben sie vermutlich riesige Ozeane mit flüssigem Wasser.
Es kann also sein, dass wir in unserem Sonnensystem noch Leben entdecken. Aber wenn, dann aller Wahrscheinlichkeit nach in einer sehr primitiven Form. Oder höchstens Lebewesen wie aus unserer Tiefsee, Anglerfische zum Beispiel, oder selbstleuchtende Quallen, die auch in völliger Dunkelheit zurechtkommen.
Ich hoffe, das beantwortet all deine Fragen.^^

Die bedeutendsten Astronomie-Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Weltall sind. Einer der namhaftesten Astronomen (Präsident der Uni Göttingen) hat um eine Unze Gold gewettet, dass man zeitlich eher Leben im Weltall entdeckt als ein Mensch den Mars zum ersten Mal betreten wird und dies wird in ca 10 Jahren der Fall sein. Die Entdeckung könnte mit Hilfe des brandneuen James-Webb-Teleskopes gelingen. Lassen wir uns also überraschen, ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich. Wenn es nicht mit dem neuen Teleskop gelingt, dann nie!

Es bestehen gute Chancen dass wir auf mind. 3 Orten bei uns im Sonnensystem aktives Leben nachweisen können in den nächsten 10 Jahren (Venus, Encelados, Europa), und auch der erste und nächst gelegene Planet den JWST ins Visier genommen hat (Proxyma B) hat extrem starke Biomarker. Alles sieht derzeit so aus als könnte Leben einfach fast überall sein, oder gewesen sein. Auf Mars sieht es sehr nach vergangenen leben aus, und selbst Merkur könnte laut neuster Forschung theoretisch noch Leben beherbergen (da gibt es aber 0 Hinweise dafür! aber es könnte theoretisch selbst dort existieren von den Bedingungen).
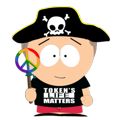
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. Mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit wimmelt und wimmelte es im Universum nur so vor Leben.