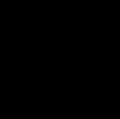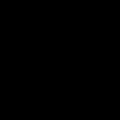Soweit ich das verstehe tritt der Effekt (Rendaku) normalerweise ein, wenn nativ japanische Wörter zusammengesetzt werden, aber nicht bei chinesischen. In Deinem Fall trifft das zu: 青 ao + 空 sora ⟶ 青空 aozora (das ist kein Problem, weil es ja kein japanisches Wort *zora geben kann, japanische Wörter lauten nicht mit z an).
Die vielen vielen chinesischen Fremdwörter im Japanischen machen da aber nicht mit, weil stimmhafter Anlauf für die chinesischen Fremdwörter häufig ist und daher Zweideutigkeiten auftreten könnten. Die Sprache kann aber nicht dauerhaft einen Unterschied zwischen nativ japanischen und ursprünglich chinesischen Wörtern machen, weil die Sprecher die Wortherkunft nach ein paar Generationen nicht mehr kennen (welcher Deutschsprecher weiß denn, daß Fenster aus dem Lateinischen, Gruppe aus dem Italienischen oder Möbel aus dem Französischen kommt?), und daher kommen Ausnahmen in jede Richtung vor.