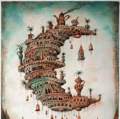Warum ist die moderne (Prädikaten-)logik nicht ontologisch neutral? George Boole vs. Aristoteles (logisches Quadrat)?
In meiner nun mehrjährigen Untersuchung der Logik muss ich zunehmend feststellen, dass die moderne Logik scheinbar einen erfolgreichen Siegeszug gegen die Vernunft geführt hat. Nicht nur das man die Konversion von Universalurteilen zu Partikularurteilen mit einem (eigentlich nicht gültigen) Existenzprädikat versehen hat, sondern das auch immer mehr unsinnige Kalküle entworfen werden, die den Satz vom Grunde nicht den nötigen Respekt entgegenbringen wollen, zeigt hier für mich ein deutliches Problem, das aber vermutlich vor allem durch Hegel, Fichte, Schopenhauer, uvm. erst hervorgebracht wurde.
Die moderne Logik vermengt nämlich (leider) viel zu oft die transzendentale, angewandte Logik mit der reinen, allgemeinen Logik. Da sagt doch ein Boole tatsächlich das Urteile der Form "Einige ... sind ..." Existenz behaupten. Ja, was für ein Unfug! Existenz gehört doch gar nicht mehr zur reinen Logik, sondern eben zur angewandten, sich mit dem Inhalt (intensional) beschäftigenden, transzendentalen Logik. Denn wer von "Existenz" spricht, der bedient sich ja schon der Kategorie der Modalität, behauptet also die Wirklichkeit eines Gegenstandes. Dann müsste ich aber doch schon im Urteil: "Alle Drachen sind Säugetiere" doch auch schon von Existenz sprechen, wenn denn schon im Partikularurteil ebenfalls existentieller Import behauptet wird. Mir erschließt sich nicht, wieso explizit gefordert wird im Syllogismus extra ein Existenzprädikat aufzuführen.
Nun, jetzt argumentiert der moderne Logiker: Aber halt! Wir gehen ja gar nicht auf die Kategorie, sondern lediglich auf die logische Gültigkeit. Aha! Nun aber muss man sich doch fragen, wenn es nur um die Urteilsform der Gültigkeit ginge, dann ist das explizite angeben der Existenz ja doch überflüssig, denn ob nun im Urteil "Einige S sind P" S nun tatsächlich existiert (also in Raum und Zeit auftretend) oder nicht, ist völlig unerheblich, denn es kommt nur auf die logische Form, nicht auf den Inhalt an. Das Urteil muss nicht gültig oder ungültig sein um im Syllogismus verwendet werden zu dürfen. Schlussfiguren der Form:
Alle S sind P => Einige P sind S
müssen daher als logisch gültig eingesehen werden, dagegen transzendentallogisch als ungültig (aber sowohl für Urteile der Form A, E, I und O). Die Existenz von "P" muss hier nicht behauptet werden, denn die logische Form nezessitiert hier ja nur, dass "S" als Art vollständig unter die Gattung "P" fällt. Demnach muss, als unmittelbarer Schluss, schon die Konversion gültig sein, dass einige P eben S sein muss, völlig unabhängig davon ob P nun existiert oder nicht. Denn um die Existenz bemühen wir uns nicht, das spielt eben erst in der angewandten, transzendentalen Logik eine Rolle. Die Behauptung es handele sich hier um eine "versteckte Prämisse" kann daher nur dann Geltung haben, wenn wir annehmen würden, dass die Konversion transzendentallogisch zu verstehen wäre. Der rein logische "rote Drache" ist etwas völlig anderes als der transzendentallogische "rote Drache". Ersterer ist lediglich ein Begriff/Konzept, der nicht an die Anschauungsformen von Raum und Zeit gebunden ist. Letzterer dagegen behauptet das tatsächliche, in der Erscheinungswelt, wirkliche Dasein eines roten Drachen.
Wie seht ihr das? Zieht ihr die aristotelische Interpretation vor oder die boolesche Interpretation? Wenn ja, begründet es bitte, und warum die boolesche Interpretation eurer Meinung nach vorgezogen werden sollte.
Warum ist die moderne Prädikatenlogik nicht ontologisch neutral (wie sie es ja eigentlich sein sollte, wenn sie sich reine Logik schimpfen möchte)?