
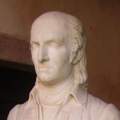
Hier eine ausführliche Antwort (oftmals hier angefragt):
Nachweise zur Spannungssteuerung des bipolaren Transistors.
1.) Der Temp.koeffizient d(Vbe)/d(T)=-2mV wurde theoretisch berechnet und messtechnisch bestätigt. Er besagt, dass man die SPANNUNG Vbe um 2mV pro Grad Temperaturerhöhung reduzieren muss, um die temperatur-bedingte Vergrößerung von Ic zu kompensieren.
Grundlage: Shockley-Gleichung mit Is (Vorfaktor vor der e-Funktion) als temperatur-sensitiver Strom.
Der Vorfaktor der Shockley-Beziehung ist überhaupt erst der physikalische Grund für die sehr starke Temperatur-Abhängigkeit des Kollektorstromes Ic.
2.) Der EarlyEffekt entsteht durch Erhöhung der Feldstärke in der (schmaler werdenden) Basiszone bei Erhöhung der C-B-Spannung (Verdrängungseffekt). Die Feldstärke wird natürlich durch die angelegte SPANNUNG Vbe (bleibt unverändert) erzeugt. Und das gilt auch für Ib=const (siehe Kennlinien).
3.) Bei der Re-Gegenkopplung wird eine SPANNUNG rückgekoppelt und reduziert Vbe (bei Vb fest). Nur in diesem Fall (Rückkopplung einer Spannung) steigt der Eingangswiderstand laut Systemtheorie (ist messtechnisch nachzuweisen). Wenn das Rückkopplungssignal ein Strom wäre, müsste der Eing.widerstand sinken.
4.) Der Basis-Spannungsteiler wird üblicherweise so niederohmig wie möglich ausgelegt (Faustformel: Teilerstrom >10*Basistrom). Warum wohl? Damit die Basis-Vorspannung Ub möglichst fest und eingeprägt angesehen werden kann und Toleranzen des (natürlich fließenden) Basisstroms sich nur gering auswirken können auf die Basis-Vorspannung Ub.
5.) Die Verstärkungsformeln für alle Grundschaltungen beinhalten als Transistorparameter nur die Steilheit gm=d(Ic)/d(Vbe). Das ist die Steigung der Kennlinie Ic=f(Vbe). Der Faktor B taucht gar nicht auf und spielt bei gleichem AP auch keine Rolle.
Die Spannungsverstärkung ist konstant - ob B=100 oder B=200 (fairer Vergleich: Gleicher Arbeitspunkt natürlich). Würde man bei bei Stromsteuerung nicht erwarten, dass die Spannungs-Verstärkung mit B auch zunimmt ?
6.) B-Betrieb des Transistors (Gegentakt-B) : Dieser Zustand wird definiert auf der Kennlinie Ic=f(Vbe) für Vbe<0,7 Volt (Grenzfall: Vbe=0V). Es fließt dabei natürlich nur ein kleinerer Kollektorstrom Ic . Das ist ja Sinn und Hintergrund der Maßnahme (spricht das für Stromsteuerung?).
Die Übernahme-Verzerrungen bei Gegentakt-B zeigen dann deutlich die Form der exponentiellen SPANNUNGS-Steuerkennlinie Ic=f(Vbe). Wie würde das bei Stromsteuerung aussehen?
7.) Beim Differenzverstärker und beim OPV ist es selbstverständich, dass man als Eingangssignal die SPANNUNG zwischen den Eingängen berücksichtigt. Über die Basis-Ströme spricht man höchstens als unerwünschte Parasitär-Effekte. Haben die Transistoren hier ihre grundsätzlichen Eigenschaften plötzlich geändert?
8.) Viele Grund-Schaltungen funktionieren nur und sind auch nur zu erklären, weil die SPANNUNG Vbe den Strom Ic bestimmt:
Stromspiegel, Kaskode-Verstärker (Basis-Schaltung), Vbe-multiplier, Bandgap-Referenz, Translinear-Schleifen, log-domain-Signalverarbeitung, Transistor in Rückopplung bei OPV`s mit log-Verstärkung,...










